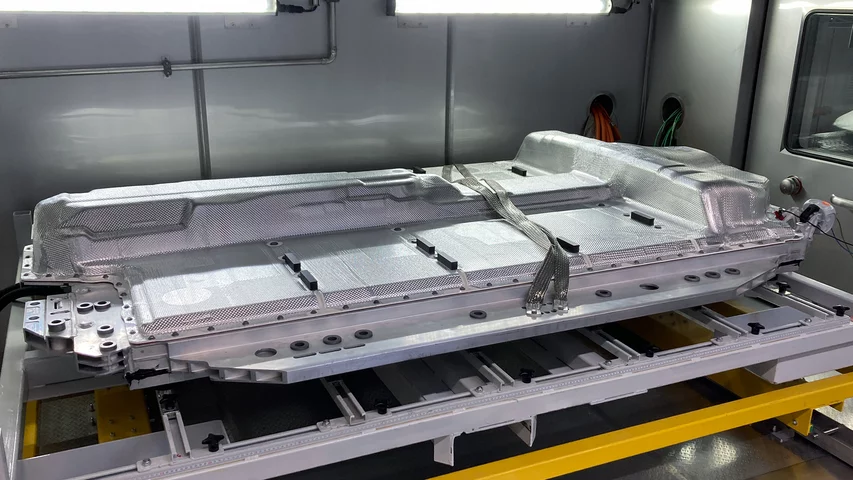Batterien altern sehr unterschiedlich

Die Antriebsbatterien von Plug-in-Hybridfahrzeugen, sogenannte PHEV, bei deinen ein Verbrenner mit einem E-Antrieb gekoppelt wird und die an der Steckdose aufgeladen werden können, büssen im Laufe ihrer Nutzungsdauer an Leistungsfähigkeit ein. Das ist logisch und nicht anders als bei reinen Elektro-Fahrzeugen.
Wie ausgeprägt dieser Effekt in der Realität ist, hat haben Techniker des grössten Automobilclub Europas, dem deutschen ADAC, nun in einer Studie genau untersucht. Sie haben dafür zusammen mit Aviloo – einem Anbieter für unabhängige Batterietests – rund 28’500 Messergebnisse der Batteriegesundheit (State of Health = SoH) von Autos sechs verschiedener Hersteller ausgewertet. Der SoH gibt an, wie viel der ursprünglichen Kapazität einer Batterie noch verfügbar ist.
Zahl der Ladezyklen entscheidend
Die Daten zeigen, dass die Alterung der Batterien je nach Hersteller und elektrischem Fahranteil sehr unterschiedlich verläuft. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass bei einem Grossteil der ausgewerteten Fahrzeuge die Antriebsbatterie ein durchschnittliches Fahrzeugleben lang halten wird. Generell gilt aber: Ein höherer elektrischer Fahranteil bedeutet mehr Ladezyklen und führt damit im Schnitt zu einer stärkeren Degradation des Akkus.
Wenn man die Modelle nach Hersteller zusammenfasst, ergibt sich folgendes Bild: Bei Fahrzeugen von Mercedes ist im Schnitt nur eine gering ausgeprägte Batteriealterung festzustellen. Bei Autos der Volkswagen-Gruppe verläuft die Alterung in der Regel in einem Rahmen, und es gibt nur wenige Ausreisser nach unten. Fahrzeuge der BMW-Gruppe zeigen ebenfalls eine erwartbare Degradation, jedoch ist die Anzahl der Ausreisser nach unten erkennbar.
Bei Plug-in-Hybride von Ford zeigt sich zu Beginn der Lebensdauer eine stärkere Alterung, welche sich aber im weiteren Verlauf abflacht. Die Datenlage für Fahrzeuge mit höheren Laufleistungen ist bei Ford allerdings noch gering, was eine Einschätzung zum weiteren Verlauf der Degradation erschwert. Tendenziell auffällig sind gemäss der ADAC-Experten die Daten von Mitsubishi: Viele Fahrzeuge in der Studie zeigen bereits nach überschaubaren Laufleistungen eine ausgeprägte Batteriealterung, die sich im weiteren Verlauf etwas stabilisiert.
Auch bei Plug-in-Hybriden Batteriecheck machen
Die Streubreite in den Studienergebnissen verdeutlicht, dass es ratsam ist, vor dem Ankauf eines gebrauchten Plug-In-Hybrids einen Batteriecheck durchführen zu lassen. Basierend auf Erfahrungswerten sollten dabei laut ADAC Experten folgende SoH-Werte erreicht werden:
- bei 50’000 km mindestens 92 Prozent
- bei 100’000 km mindestens 88 Prozent
- bei 150’000 km mindestens 84 Prozent
- bei 200’000 km mindestens 80 Prozent
Liegt der Wert spürbar darunter, könnte dies ein Hinweis auf eine übermässig gealterte Batterie oder defekte Batteriezellen sein. Der Austausch einer defekten Plug-in-Antriebsbatterie bei einem gebrauchten Fahrzeug kann im ungünstigsten Fall einen wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten. Gegenüber den Herstellern fordert der ADAC deshalb, dass die Batterie eines Plug-in-Hybrids auch bei hohen elektrischen Fahranteilen mindestens 200’000 km halten muss.